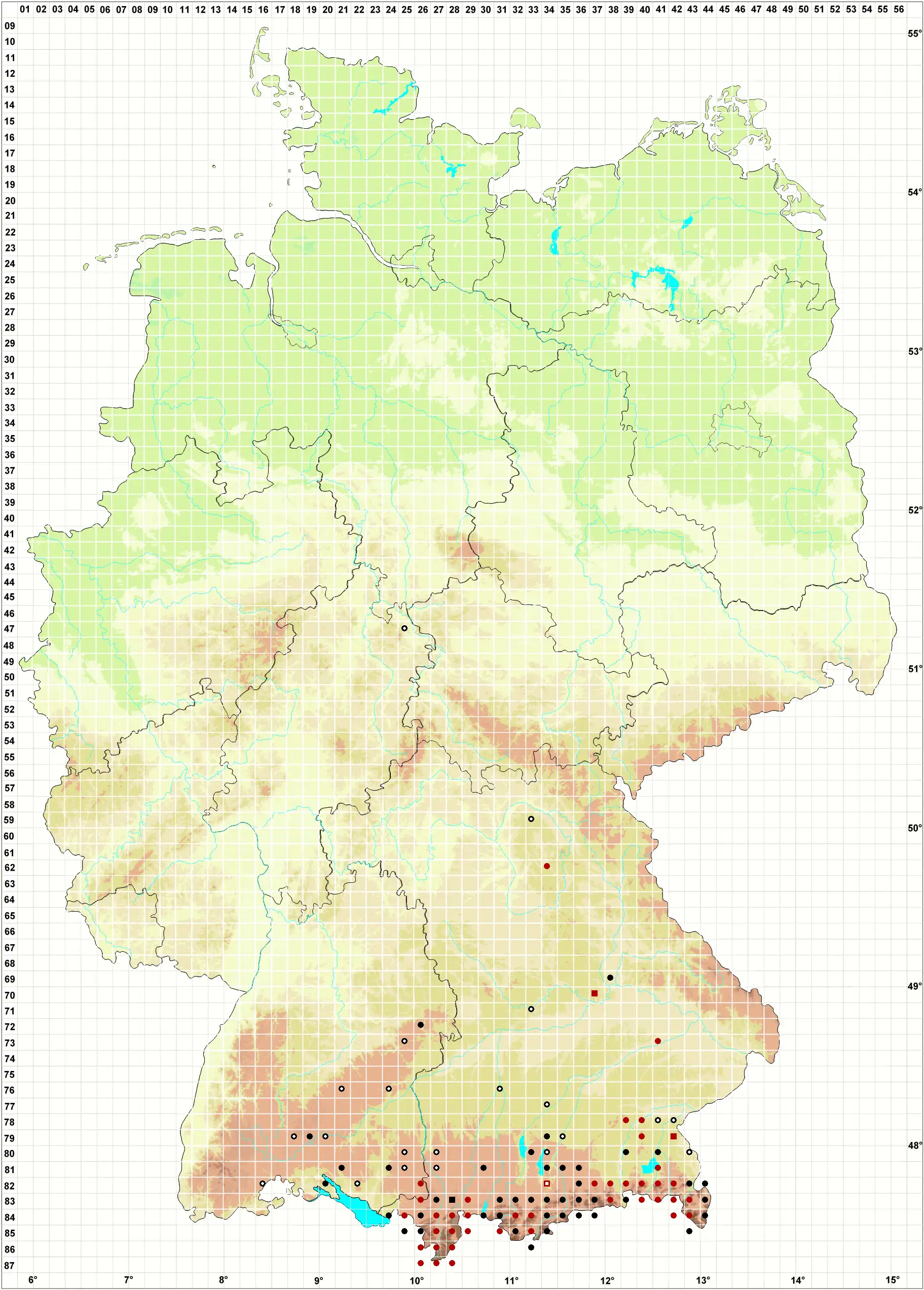Barbula crocea (Brid.) F.Weber & D.Mohr
Bot. Taschenb. (Weber): 481. 1807
Deutscher Name: Safran-Bärtchenmoos, Sumpf-Bärtchenmoos
Systematik: Equisetopsida > Bryidae > Pottiaceae > Pottiales > Pottiaceae > Barbula
Synonyme: Barbula paludosa F.Weber & D.Mohr, Streblotrichum croceum (Brid.) Loeske, Streblotrichum paludosum J.J.Amann, Tortula crocea Brid.

In unserer Datenbank gibt es 1 Datensatz.
Bitte klicken Sie die Karte für Details. [ Verbreitung in Deutschland ]
[ Verbreitung in Deutschland ]
Beschreibung der Art
Habitat/Ökologie (Meinunger & Schröder 2007)
Verbreitung (Meinunger & Schröder 2007)
Bestand und Gefährdung (Meinunger & Schröder 2007)
Verwandte Arten
- → Barbula abbreviatifolia H.Müll.
- → Barbula acuta (Brid.) Brid.
- → Barbula acuta subsp. icmadophila (Müll.Hal.) J.J.Amann
- → Barbula acuta var. icmadophila (Müll.Hal.) H.A.Crum
- → Barbula adriatica Baumgartner
- → Barbula alpina Bruch & Schimp.
- → Barbula ambigua Bruch & Schimp.
- → Barbula amplexifolia (Mitt.) A.Jaeger
- → Barbula andreaeoides Kindb.
- → Barbula asperifolia Mitt.
- → Barbula asperifolia var. kneuckeri (Loeske & Osterwald) Wijk & Margad.
- → Barbula bicolor (Bruch & Schimp.) Lindb.
- → Barbula botelligera Mönk.
- → Barbula brebissonii Brid.
- → Barbula commutata Jur.
- → Barbula convoluta Hedw.
- → Barbula convoluta Hedw. var. convoluta
- → Barbula convoluta var. commutata (Jur.) Husn.
- → Barbula convoluta var. sardoa Schimp.
- → Barbula convoluta var. uliginosa (Limpr.) Limpr.
- → Barbula cordata (Jur.) Loeske
- → Barbula cylindrica (Taylor) Schimp.
- → Barbula cylindrica var. sinuosa (Mitt.) Lindb.
- → Barbula danica M. T. Lange
- → Barbula enderesii Garov.
- → Barbula fallax Hedw.
- → Barbula ferruginascens Stirt.
- → Barbula ferruginea Schimp. ex Besch.
- → Barbula flavipes Bruch & Schimp.
- → Barbula gigantea Funck
- → Barbula glauca (Ryan) H.Möller
- → Barbula gracilis Schwägr.
- → Barbula gracilis var. icmadophila (Müll.Hal.) Mönk.
- → Barbula hornschuchiana Schultz
- → Barbula humilis Hedw.
- → Barbula icmadophila Schimp. ex Müll.Hal.
- → Barbula inclinata var. densa Lorentz & Molendo
- → Barbula insidiosa Jur. & Milde
- → Barbula kneuckeri Loeske & Osterwald
- → Barbula laevipila var. meridionalis Schimp.
- → Barbula leucostoma R.Br.
- → Barbula lingulata Warnst.
- → Barbula lurida Hornsch.
- → Barbula mamillosa Crundw.
- → Barbula marginata Bruch & Schimp.
- → Barbula mucronata Brid.
- → Barbula muelleri Bruch & Schimp.
- → Barbula muralis var. obcordata Schimp.
- → Barbula nicholsonii Culm.
- → Barbula obtusifolia Schwägr.
- → Barbula pagorum Milde
- → Barbula paludosa F.Weber & D.Mohr
- → Barbula poenina J.J.Amann
- → Barbula pulvinata Jur.
- → Barbula recurvirostra (Hedw.) Dixon
- → Barbula reflexa (Brid.) Brid.
- → Barbula revoluta Brid.
- → Barbula revolvens Schimp.
- → Barbula rigida Hedw.
- → Barbula rigidula (Hedw.) Mitt.
- → Barbula rigidula subsp. verbana (W.E.Nicholson & Dixon) Podp.
- → Barbula rigidula var. glauca (Ryan) J.J.Amann
- → Barbula rigidula var. valida (Limpr.) Broth.
- → Barbula rufa (Lorentz) Jur.
- → Barbula ruraliformis Besch.
- → Barbula ruralis Hedw.
- → Barbula ruralis var. calva Durieu & Sagot
- → Barbula sardoa (Schimp.) J.-P.Frahm
- → Barbula sinensis Müll.Hal.
- → Barbula sinuosa (Mitt.) Grav.
- → Barbula spadicea (Mitt.) Braithw.
- → Barbula squamifera Viv.
- → Barbula squarrosa Brid.
- → Barbula subandreaeoides Kindb.
- → Barbula subulata var. angustata Schimp.
- → Barbula subulata var. subinermis Bruch & Schimp.
- → Barbula tomaculosa Blockeel
- → Barbula tophacea (Brid.) Mitt.
- → Barbula trifaria auct. non (Hedw.) Mitt.
- → Barbula umbrosa Müll.Hal.
- → Barbula unguiculata Hedw.
- → Barbula vahliana Schultz
- → Barbula valida (Limpr.) H.Möller
- → Barbula vinealis Brid.
- → Barbula vinealis subsp. cylindrica (Taylor) Podp.
- → Barbula vinealis var. cylindrica (Taylor) Boulay
- → Barbula vinealis var. flaccida Bruch & Schimp.