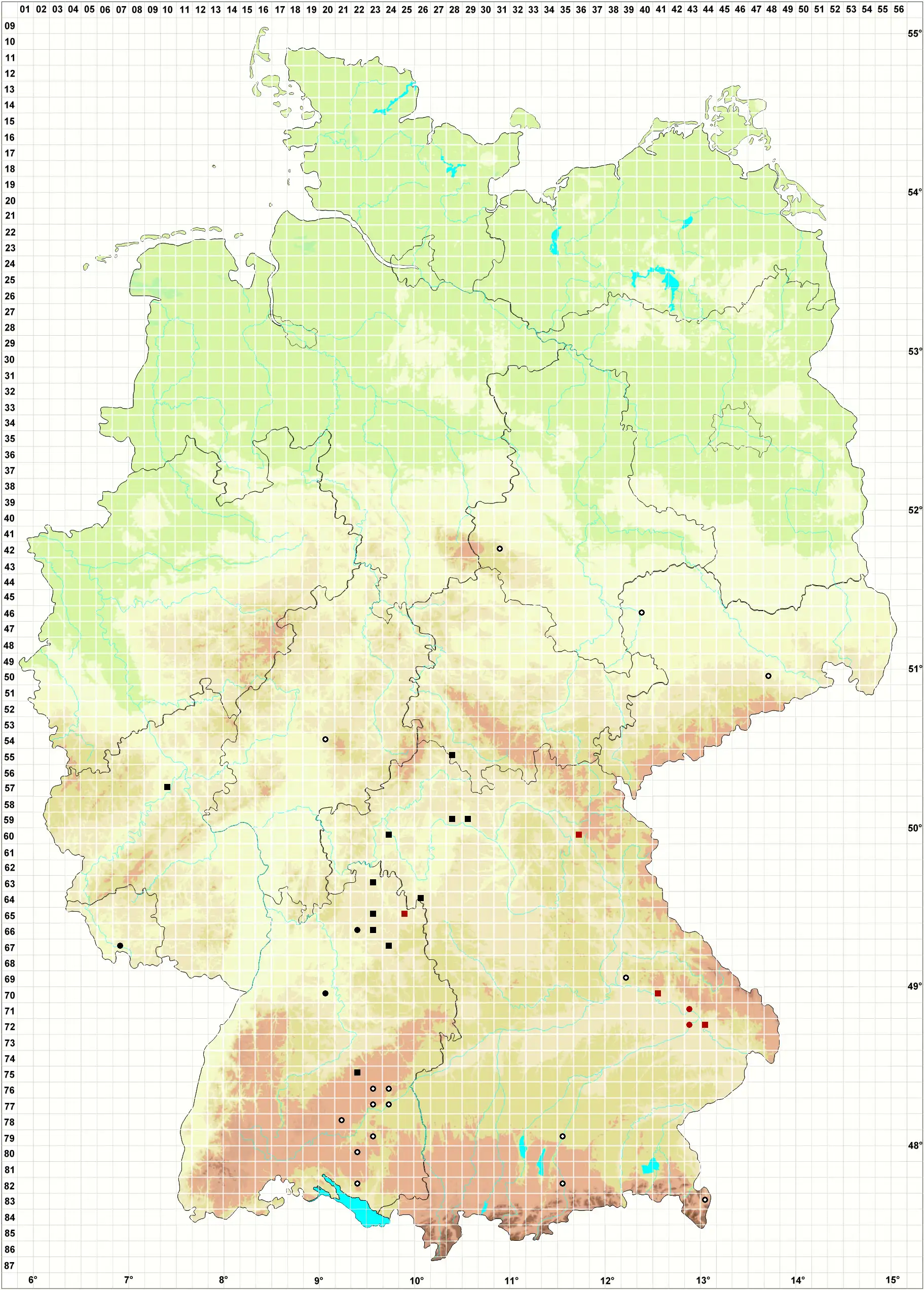Brachythecium capillaceum (F.Weber & D.Mohr) Giacom.
Atti Ist. Bot. Lab. Crittog. Univ. Pavia 5(4): 268. 1947
Deutscher Name: Feinblättriges Kurzbüchsenmoos, Haarähnliches Kurzbüchsenmoos
Systematik: Equisetopsida > Bryidae > Thuidiaceae > Hypnales > Brachytheciaceae > Brachythecium
Synonyme: Brachythecium rotaeanum De Not., Brachythecium salebrosum subsp. rotaeanum (De Not.) J.J.Amann, Brachythecium salebrosum var. capillaceum (F.Weber & D.Mohr) Lorentz, Brachythecium salebrosum var. cylindricum Schimp., Chamberlainia rotaeana (De Not.) H.Rob., Hypnum salebrosum var. capillaceum F.Weber & D.Mohr

In unserer Datenbank gibt es 1 Datensatz.
Bitte klicken Sie die Karte für Details. [ Verbreitung in Deutschland ]
[ Verbreitung in Deutschland ]
Beschreibung der Art
Habitat/Ökologie (Meinunger & Schröder 2007)
Verbreitung (Meinunger & Schröder 2007)
Bestand und Gefährdung (Meinunger & Schröder 2007)
Verwandte Arten
- → Brachythecium acutum (Mitt.) Sull.
- → Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp.
- → Brachythecium albicans var. dumetorum Limpr.
- → Brachythecium albicans var. julaceum Warnst.
- → Brachythecium alpinum (De Not.) Anzi
- → Brachythecium amoenum Milde
- → Brachythecium angustirete Broth.
- → Brachythecium appleyardiae McAdam & A.J.E.Sm.
- → Brachythecium caespitosum (Wilson) Dixon
- → Brachythecium campestre (Müll.Hal.) Schimp.
- → Brachythecium cardotii H.Winter
- → Brachythecium cirrosum (Schwägr.) Schimp.
- → Brachythecium collinum (Müll.Hal.) Schimp.
- → Brachythecium curtum (Lindb.) Limpr.
- → Brachythecium dovrense (Limpr.) J.J.Amann
- → Brachythecium erythrorrhizon Schimp.
- → Brachythecium erythrorrhizon Schimp. var. erythrorrhizon
- → Brachythecium funckii Schimp.
- → Brachythecium geheebii Milde
- → Brachythecium glaciale Schimp.
- → Brachythecium glaciale var. dovrense Limpr.
- → Brachythecium glareosum (Bruch ex Spruce) Schimp.
- → Brachythecium graniticum W.Gümbel
- → Brachythecium illecebrum auct.
- → Brachythecium jucundum De Not.
- → Brachythecium kosaninii Podp.
- → Brachythecium laetum (Brid.) Schimp.
- → Brachythecium lanceolatum Warnst.
- → Brachythecium latifolium Kindb.
- → Brachythecium ligusticum De Not.
- → Brachythecium micropus Schimp.
- → Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp.
- → Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp. var. mildeanum
- → Brachythecium nelsonii Grout
- → Brachythecium oedipodium (Mitt.) A.Jaeger
- → Brachythecium ornellanum (Molendo) Venturi & Bott.
- → Brachythecium oxycladon auct. plur. non (Brid.) A.Jaeger
- → Brachythecium payotianum Schimp. ex Boulay
- → Brachythecium piliferum (Hedw.) Kindb.
- → Brachythecium plicatum (F.Weber & D.Mohr) Schimp.
- → Brachythecium plumosum (Hedw.) Schimp.
- → Brachythecium polygamum Warnst.
- → Brachythecium populeum (Hedw.) Schimp.
- → Brachythecium populeum var. amoenum (Milde) Limpr.
- → Brachythecium populeum var. longisetum Schimp.
- → Brachythecium populeum var. majus Schimp.
- → Brachythecium populeum var. rufescens Schimp.
- → Brachythecium populeum var. subfalcatum Schimp.
- → Brachythecium purum (Hedw.) Dixon
- → Brachythecium reflexum (Starke) Schimp.
- → Brachythecium rivulare Schimp.
- → Brachythecium rotaeanum De Not.
- → Brachythecium ruebelii Herzog
- → Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp.
- → Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp. var. rutabulum
- → Brachythecium ryanii Kaur.
- → Brachythecium salebrosum (Hoffm. ex F.Weber & D.Mohr) Schimp.
- → Brachythecium salebrosum subsp. rotaeanum (De Not.) J.J.Amann
- → Brachythecium salebrosum var. capillaceum (F.Weber & D.Mohr) Lorentz
- → Brachythecium salebrosum var. cylindricum Schimp.
- → Brachythecium salebrosum var. palustre Schimp.
- → Brachythecium salicinum Schimp.
- → Brachythecium saltense I.Hagen
- → Brachythecium starkei (Brid.) Schimp.
- → Brachythecium starkei var. curtum (Lindb.) Warnst.
- → Brachythecium starkei var. explanatum auct. non (Brid.) Mönk.
- → Brachythecium starkei var. explanatum (Brid.) Mönk.
- → Brachythecium starkei var. tenuicuspis Mönk.
- → Brachythecium starkei var. tromsoeense (Kaurin & Arnell) Nyholm
- → Brachythecium subalbicans De Not.
- → Brachythecium tauriscorum Mol.
- → Brachythecium tauriscorum Molendo
- → Brachythecium tommasinii (Sendtn. ex Boulay) Ignatov & Huttunen
- → Brachythecium trachypodium (Brid.) Schimp.
- → Brachythecium trachypodium var. payotianum (Boulay) Bott.
- → Brachythecium tromsoeense (Kaurin & Arnell) Limpr.
- → Brachythecium turgidum (Hartm.) Kindb.
- → Brachythecium udum (I.Hagen) I.Hagen
- → Brachythecium vagans Milde
- → Brachythecium validum (C.E.O.Jensen) Broth.
- → Brachythecium velutinum (Hedw.) Schimp.
- → Brachythecium velutinum (Hedw.) Schimp. var. velutinum
- → Brachythecium velutinum var. condensatum Schimp.
- → Brachythecium velutinum var. graniticum Mönk.
- → Brachythecium velutinum var. intricatum (Hedw.) Schimp.
- → Brachythecium velutinum var. praelongum Schimp.
- → Brachythecium velutinum var. salicinum (Schimp.) Mönk.
- → Brachythecium velutinum var. vagans (Milde) Warnst.
- → Brachythecium venustum (De Not.) De Not.
- → Brachythecium vineale Milde