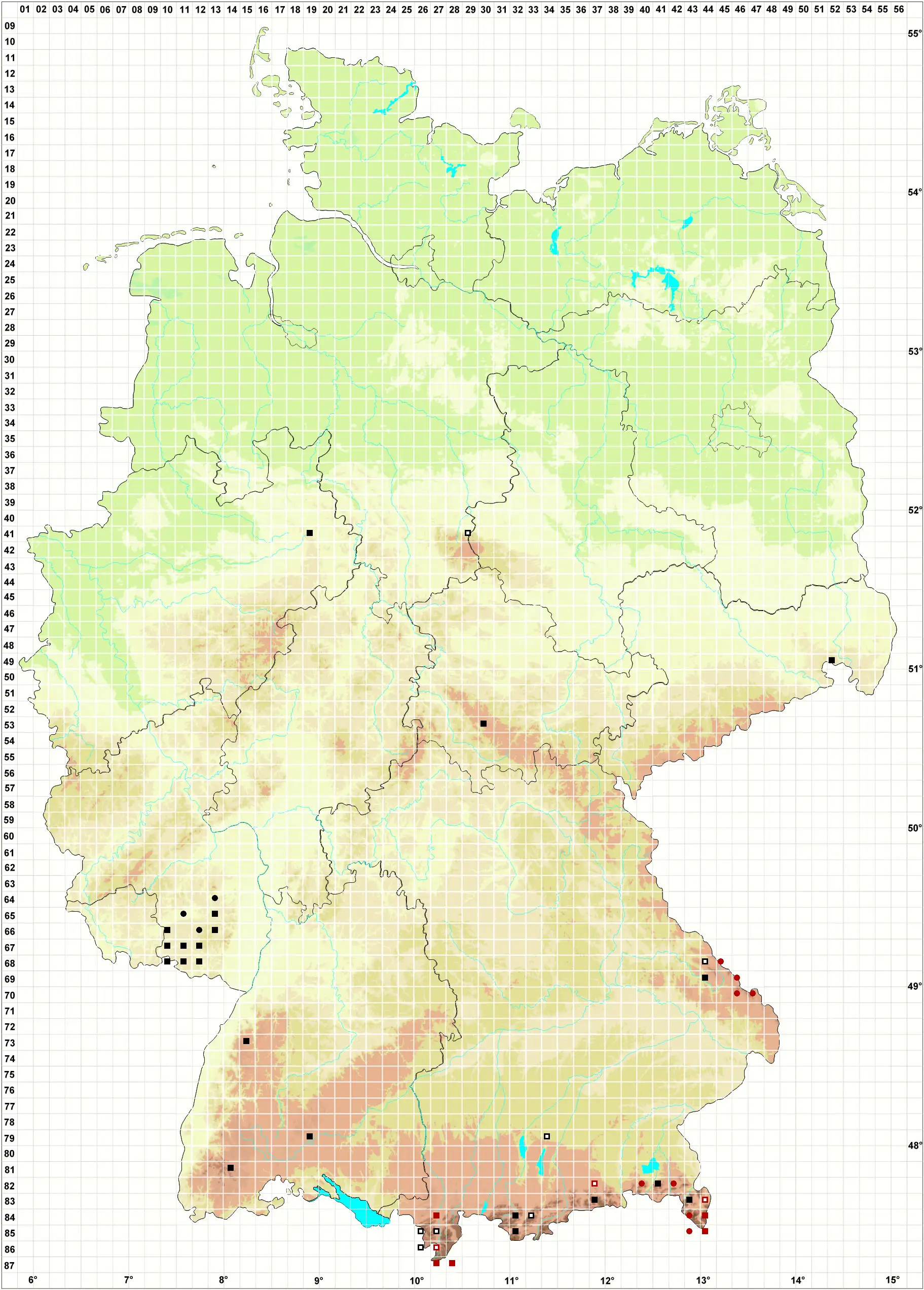In unserer Datenbank gibt es 1 Datensatz.
Bitte klicken Sie die Karte für Details. [ Verbreitung in Deutschland ]
[ Verbreitung in Deutschland ]
Beschreibung der Art
Habitat/Ökologie (Meinunger & Schröder 2007)
Verbreitung (Meinunger & Schröder 2007)
Bestand und Gefährdung (Meinunger & Schröder 2007)
Verwandte Arten
- → Lophozia acutiloba Schiffn.
- → Lophozia alpestris auct. non (F.Weber) A.Evans
- → Lophozia alpestris (F.Weber) A.Evans
- → Lophozia ascendens (Warnst.) R.M.Schust.
- → Lophozia attenuata (Mart.) Dumort.
- → Lophozia badensis (Gottsche) Schiffn.
- → Lophozia bantriensis (Hook.) Steph.
- → Lophozia bantriensis var. subcompressa (Limpr.) Schiffn.
- → Lophozia barbata (Schreb.) Dumort.
- → Lophozia bicrenata (Hoffm.) Dumort.
- → Lophozia capitata (Hook.) Macoun
- → Lophozia capitata subsp. laxa (Lindb.) Bisang
- → Lophozia collaris (Nees) Dumort.
- → Lophozia decolorans (Limpr.) Steph.
- → Lophozia ehrhartiana (F.Weber) Inoue & Steere
- → Lophozia elongata Steph.
- → Lophozia excisa (Dicks.) Dumort.
- → Lophozia excisa (Dicks.) Dumort. var. excisa
- → Lophozia excisa var. cylindrica (Dumort.) Müll.Frib.
- → Lophozia floerkei (F.Weber & D.Mohr) Schiffn.
- → Lophozia gillmanii (Austin) R.M.Schust.
- → Lophozia grandiretis (Kaal.) Schiffn.
- → Lophozia grandiretis var. volutabrica Müll.Frib.
- → Lophozia hatcheri (A.Evans) Steph.
- → Lophozia herzogiana E.A.Hodgs. & Grolle
- → Lophozia heterocolpos (Hartm.) M.Howe
- → Lophozia incisa (Schrad.) Dumort.
- → Lophozia incisa (Schrad.) Dumort. subsp. incisa
- → Lophozia inflata (Huds.) M.Howe
- → Lophozia kaurinii (Limpr.) Steph.
- → Lophozia kiaeri Jörg.
- → Lophozia kunzeana (Huebener) A.Evans
- → Lophozia laxa (Lindb.) Grolle
- → Lophozia longidens (Lindb.) Macoun
- → Lophozia longidens subsp. longidens
- → Lophozia longiflora auct. non (Nees) Schiffn.
- → Lophozia longiflora (Nees) Schiffn.
- → Lophozia lycopodioides (Wallr.) Cogn.
- → Lophozia marchica (Limpr.) Steph.
- → Lophozia mildeana (Gottsche) Schiffn.
- → Lophozia muelleri (Lindenb.) Dumort.
- → Lophozia obtusa (Lindb.) A.Evans
- → Lophozia opacifolia Culm. ex Meyl.
- → Lophozia perssonii H.Buch & S.W.Arnell
- → Lophozia porphyroleuca auct.
- → Lophozia quadriloba (Lindb.) A.Evans
- → Lophozia quinquedentata (Huds.) Cogn.
- → Lophozia schultzii (Nees) Schiffn.
- → Lophozia silvicola H.Buch
- → Lophozia sudetica (Huebener) Grolle
- → Lophozia turbinata (Raddi) Steph.
- → Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort.
- → Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort. var. ventricosa
- → Lophozia ventricosa var. longiflora auct. non (Nees) Macoun
- → Lophozia ventricosa var. silvicola (H.Buch) E.W.Jones ex R.M.Schust.
- → Lophozia ventricosa var. uliginosa Schiffn.
- → Lophozia wenzelii (Nees) Steph.
- → Lophozia wenzelii var. wenzelii