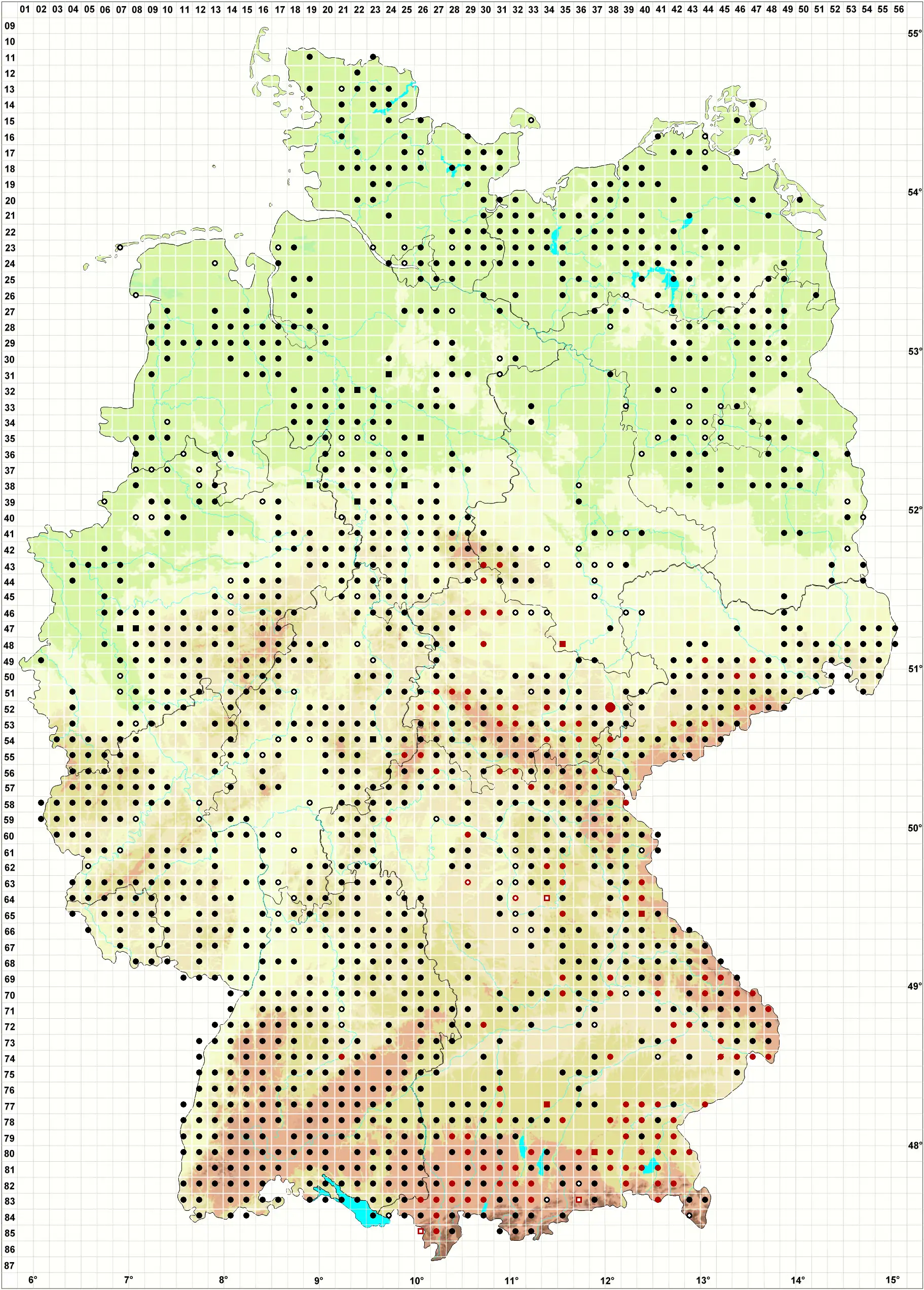Fontinalis antipyretica Hedw.
Sp. Musc. Frond.: 298. 1801
Deutscher Name: Gemeines Brunnenmoos
Systematik: Equisetopsida > Bryidae > Thuidiaceae > Hypnales > Fontinalaceae > Fontinalis
Synonyme: Fontinalis androgyna R.Ruthe, Fontinalis antipyretica Hedw. var. antipyretica, Fontinalis antipyretica subsp. gracilis (Lindb.) Kindb., Fontinalis antipyretica subsp. kindbergii (Renauld & Cardot) Cardot, Fontinalis antipyretica var. cymbifolia W.E.Nicholson, Fontinalis antipyretica var. gigantea (Sull.) Sull., Fontinalis antipyretica var. gracilis (Lindb.) Schimp., Fontinalis arvernica (Renauld) Cardot, Fontinalis cavifolia Warnst. & M.Fleisch., Fontinalis dolosa Cardot, Fontinalis fasciculata Lindb., Fontinalis gigantea Sull., Fontinalis gothica Cardot & Arnell, Fontinalis gracilis Lindb., Fontinalis howellii Renauld & Cardot, Fontinalis islandica Cardot, Fontinalis kindbergii Renauld & Cardot, Fontinalis longifolia C.E.O.Jensen, Fontinalis sparsifolia Limpr., Fontinalis thulensis C.E.O.Jensen

In unserer Datenbank gibt es 349 Datensätze .
Bitte klicken Sie die Karte für Details. [ Verbreitung in Deutschland ]
[ Verbreitung in Deutschland ]
Fertilität
Höhenverteilung
Beschreibung der Art
Verwandte Arten
- → Fontinalis androgyna R.Ruthe
- → Fontinalis antipyretica Hedw. var. antipyretica
- → Fontinalis antipyretica subsp. gracilis (Lindb.) Kindb.
- → Fontinalis antipyretica subsp. kindbergii (Renauld & Cardot) Cardot
- → Fontinalis antipyretica var. cymbifolia W.E.Nicholson
- → Fontinalis antipyretica var. gigantea (Sull.) Sull.
- → Fontinalis antipyretica var. gracilis (Lindb.) Schimp.
- → Fontinalis arvernica (Renauld) Cardot
- → Fontinalis camusii Cardot
- → Fontinalis capillacea Dicks.
- → Fontinalis cavifolia Warnst. & M.Fleisch.
- → Fontinalis dixonii Cardot
- → Fontinalis dolosa Cardot
- → Fontinalis duriaei Schimp.
- → Fontinalis fasciculata Lindb.
- → Fontinalis gigantea Sull.
- → Fontinalis gothica Cardot & Arnell
- → Fontinalis gracilis Lindb.
- → Fontinalis howellii Renauld & Cardot
- → Fontinalis hypnoides C.Hartm.
- → Fontinalis hypnoides C.Hartm. var. hypnoides
- → Fontinalis hypnoides var. duriaei (Schimp.) Husn.
- → Fontinalis islandica Cardot
- → Fontinalis kindbergii Renauld & Cardot
- → Fontinalis longifolia C.E.O.Jensen
- → Fontinalis nitida Lindb. & Arnell
- → Fontinalis sparsifolia Limpr.
- → Fontinalis squamosa Hedw.
- → Fontinalis squamosa Hedw. var. squamosa
- → Fontinalis squamosa var. dixonii (Cardot) A.J.E.Sm
- → Fontinalis thulensis C.E.O.Jensen